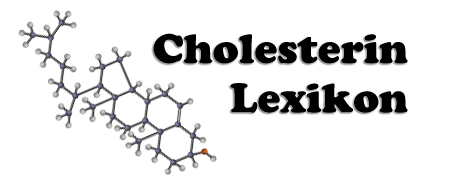Die alternative Alternative zu den alternativlosen Statinen
Bevor ich zum roten Reis komme ein kurzes Wort zu den „klassischen Cholesterinsenkern“: den Statinen sind deren Nebenwirkungen.
Selbstverständlich werden diese im sogenannten „Nutzen-Risiko-Verhältnis“ klein gerechnet. Denn jeder ordentliche Schulmediziner kann bezeugen, dass der Nutzen der Statine mögliche Nebenwirkungen weit übersteigt. Wie gesagt, es handelt sich hier nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um aus der Praxis gewonnene „Einsichten“.
Dem gegenüber stehen eine Reihe von Studien mit beträchtlichen Nebenwirkungen. Und demgegenüber stehen die pharmakologischen Profile für Nebenwirkungen für Statine, wie man sie zum Beispiel bei Drugs.com einsehen kann. Die Liste der Nebenwirkungen ist nicht nur lang, sondern weist auch eine große Variationsbreite auf.
Was liegt hier also näher als eine Senkung von Cholesterin durch „natürliche Mittel“ – der Traum für eine Reihe von Alternativmedizinern. Denn wir wissen ja, dass natürliche Substanzen angeblich kaum oder keine Nebenwirkungen haben, ohne dabei signifikant an therapeutischen Effekten einbüßen zu müssen – in der Regel zumindest.
Und hier kommt bei der Cholesterinsenkung eine spezifische Sorte von Reis ins Spiel, der „rote Reis“.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter dazu an:
Roter Reis
Bei diesem Reis handelt es sich erst einmal um ein traditionelles chinesisches Produkt. Dieser Reis wird durch die Fermentation von gekochtem, weißem Reis hergestellt. Der Schimmelpilz, der die Fermentierung bewirkt, baut eine Reihe von Substanzen auf, die dann zu der Rotfärbung des Fermentierungsprodukts führen.
Aber, der Reis wird nicht nur rot, sondern enthält auch sogenannte Monacoline. Einer dieser Monacoline ist das Monacolin K. Und diese Substanz wiederum ist identisch mit einem Pharmaprodukt, dem Cholesterinsenker Lovastatin.
Wir haben hier die etwas „unangenehme Situation“, dass Lovastatin als Pharmaprodukt nichts im alternativmedizinischen Behandlungskonzept zu suchen hat, aber die gleiche Substanz als natürlicher Bestandteil von rotem Reis dann plötzlich die alternativmedizinische „Absolution“ erteilt bekommt beziehungsweise bekommen muss, da es sich ja um etwas „Natürliches“ handelt.
Wie wird dieser Widerspruch aufgelöst?
Die alternativmedizinische Quadratur des Kreises
Es gibt bereits einige mehr oder weniger „wissenschaftliche“ Beiträge von Seiten der Schulmedizin, die natürlich das gleiche Problem hat. Für sie soll plötzlich eine natürliche Substanz die Wirksamkeit haben, die sie natürlichen Substanzen in der Regel von vornherein abspricht. Aber man ist hier relativ pragmatisch und kümmert sich wenig um diesen offensichtlichen Widerspruch.
Statt dessen fordert man kategorisch, dass roter Reis wegen seines Gehaltes an Monacolin K zu einem zulassungspflichtigen Medikament erklärt wird.
Das ist natürlich überhaupt nicht nach dem Geschmack der Alternativmediziner.
Denn die möchten gerne den roten Reis als natürlichen Cholesterinsenker ohne Einschränkungen weiter verwenden können. Und dieses Problem schien einen ganzheitlich arbeitenden Mediziner bewegt zu haben, hier einmal eine ordentliche Aufarbeitung des Problems zu präsentieren, und zwar in Form eines Newsletters .
Laut seinen Aussagen hat er eine Reihe von Patienten, die Statine wegen entsprechender Nebenwirkungen absetzen mussten, aber unter rotem Reis die gleiche cholesterinsenkende Wirkung wie unter den Statinen aufwiesen, ohne aber die entsprechenden Nebenwirkungen zu haben. Das hört sich vielversprechend an.
Man fragt sich natürlich sofort, wie kann es sein, dass Lovastatin in der Tablette so viele Nebenwirkungen macht, im roten Reis dagegen wesentlich verträglicher zu sein scheint? Oder ist Lovastatin per se einer der verträglicheren Vertreter der Statine?
Es scheint dazu ein paar Arbeiten zu geben, deren Fragestellung in diese Richtung geht. Eine Zusammenfassung in PubMed berichtet, dass es klinische Studien dazu gibt. Aber – der kommerziell angebotene rote Reis muss nicht notwendigerweise signifikante Mengen an Monacolin K aufweisen. Die Variationsbreite scheint von „kein Monacolin“ bis „hohe Konzentrationen“ zu reichen.
In den klinischen Studien wurde natürlich sichergestellt, dass hier Reissorten zum Einsatz kamen, die signifikante Konzentrationen aufwiesen. Ob man beim Kauf von rotem Reis den „klinisch wirksamen Reis“ erhält, ist ungewiss. Das könnte ein Grund für die bessere „Verträglichkeit“ von rotem Reis im Vergleich zu Statinen sein.
Da erhebt sich sofort die Frage: „Aber der Effekt ist doch da.“
In dem Beitrag vom PubMed wird sogar von zwei Studien berichtet, die ihrerseits von Patienten berichteten, die schwere Nebenwirkungen durch Statine erfuhren (Muskelschmerzen, Schwächung der Muskulatur etc.). Ein Umstellen auf roten Reis löste diese Probleme. Hier wusste man dann nicht, ob hier geringere Mengen an Monacolin K für die Verbesserung verantwortlich waren. Oder ob es sich hier um andere Faktoren handelt, die die Nebenwirkungen von Monacolin K aufzufangen in der Lage sind.
Eine weitere klinische Studie zeigte einen viel höheren cholesterinsenkenden Effekt als die verabreichte Konzentration an Monacolin K erwarten ließ. Man vermutete hier, dass möglicherweise andere Monacoline oder andere Substanzen im roten Reis zu dieser unerwartet hohen Cholesterinsenkung verholfen hatten.
Und weil man sich das alles nicht hat erklären können, hatte die FDA 1998 beschlossen, roten Reis mit signifikanten Konzentrationen an Monacolin K zu einem „nicht zugelassenen Medikament“ zu erklären.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter dazu an:
Was sagt der Newsletter?
Im zweiten Absatz, wo die Diskussion beginnt, schreibt Dr. Schmiedel einen bemerkenswerten Satz: „In Studien, ja sogar in Meta-Analysen hat sich Roter Reis mittlerweile als den Statinen bezüglich der Cholesterinsenkung als gleichwertig erwiesen“.
Es mag formalistisch erscheinen, aber Metaanalysen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Steigerungsform von klinischen Studien. Im Gegenteil! Und be- und erweisen können diese Studien überhaupt nichts. Damit wären wir wieder bei der schulmedizinischen Vergewaltigung von Statistiken zum Wohl der eigenen interessierten Aussagen. Das scheint auch vor alternativmedizinisch ausgerichteten Medizinern nicht halt zu machen.
Der darauf folgende Text ist relativ lang und lobt die Vorzüge von rotem Reis und verdammt die Statine. Es werden Studien zitiert, die von einer gleichen beziehungsweise vergleichbaren Wirkung berichten, verbunden mit einer viel geringeren Nebenwirkungsrate beim roten Reis.
Eine klinische Studie aus dem Jahr 2010 aus China berichtete sogar bei über 2700 Studienteilnehmern signifikante Effekte im Vergleich zu Placebo. Allerdings handelt es sich bei den Teilnehmern um ein sehr selektiertes „Klientel“: Patienten mit Hypertonie und einem bereits durchgemachten Herzinfarkt.
Unter diesen Voraussetzungen würde ich sagen, dass roter Reis bei Hypertonikern mit durchgemachten Herzinfarkt eine gute Therapiealternative darstellen könnte. Diese Ergebnisse sagen keinesfalls, dass wir jetzt alle nur noch roten Reis essen müssen.
Jetzt steht natürlich immer noch die Frage nach den „gefährlichen Nebenwirkungen“ im Raum. Denn Lovastatin mit den vielen Nebenwirkungen soll plötzlich als roter Reis „verkleidet“ kaum noch Nebenwirkungen haben? Wie kann das angehen?
Dazu zitierte Autor eine italienische Studie aus dem Jahr 2017. Es scheint in Italien ein Überwachungssystem für natürliche Gesundheitsprodukte zu geben, das hier zurate gezogen wurde. Die Autoren sahen in dem Zeitraum vom April 2002 bis September 2015 rund 1260 Berichte. Davon waren 52 Berichte, die 55 Nebenwirkungen von rotem Reis dokumentierten. 13 Patienten mussten ins Krankenhaus. Ein Patient verstarb als Folge des Konsums von rotem Reis, während 31 Todesopfer „möglicherweise“ an den Folgen von rotem Reis verstarben.
Daraus folgern die Autoren, dass das Sicherheitsprofil von rotem Reis vergleichbar ist mit dem von Statinen. Das heißt nichts anderes, als dass roter Reis auf die Liste der nicht registrierten Medikamente gehört.
Dr. Schmiedel diskutiert diese Studie so, dass daraus ein Problem der Statistik wird. Die Nebenwirkungen sind da, ja, aber … 55 Nebenwirkungen in 13 Jahren kann man wirklich nicht als überwältigend viel bezeichnen.
Aber es sind ja nicht nur die Häufigkeiten von Nebenwirkungen, die bei Statinen nicht selten zum Therapieabbruch führen. Dazu kommt, dass die Varianz der Nebenwirkungen auf verschiedene Organsysteme beeindruckend groß ist. Um dies zu beweisen, zitiert er das „Schweizer Medikamenten-Kompendium“ für Atorvastatin.
Lovastatin und Atorvastatin sind zwar beide Mitglieder der Familie der Statine, aber von ihrer biochemischen Struktur vollkommen unterschiedliche Substanzen. Von daher ist ein Vergleich von rotem Reis mit Atorvastatin nicht unbedingt eine sehr wissenschaftliche Vorgehensweise.
Oder hatte der Autor Befürchtungen, dass entsprechende Informationen zum Lovastatin kein so erschreckendes Bild abgeben würden? Ich kann ihn da beruhigen. Denn unter Drugs.com gibt es für Lovastatin und Nebenwirkungen eine fast gleich lange „Litanei“ an üblichen Nebenwirkungen.
Aber damit sind wir immer noch keinen Schritt weiter zu erklären, warum Lovastatin schlecht ist und roter Reis gut sein muss. Im weiteren Verlauf des Newsletters werden die Nöte des Schreibers auch nicht gelindert, obwohl immer mehr Erklärungen zu verschiedenen Sachverhalten hinzugefügt werden, die aber alles andere als den Widerspruch klären…
Ein letzter Versuch, hier Licht ins Dunkel zu bringen, ist wieder einmal ein auf der Statistik beruhender Erklärungsversuch. Denn der Unterschied zwischen Lovastatin und rotem Reis beruht demnach auf absoluten und relativen Häufigkeiten, die angeblich von Wissenschaftlern „in Gänsefüßchen“ nicht erkannt werden.
Hier soll angeblich die relative Häufigkeit von Nebenwirkungen den Unterschied zwischen Lovastatin und rotem Reis ausmachen. Und wer das nicht tut, der wird von Dr. Schmiedel als „dumm und naiv“ geadelt, der darüber hinaus noch die Rückgabe der akademischen Titel fordert. Auch das ist nicht unbedingt die Art und Weise, sich wissenschaftlich auseinanderzusetzen.
Relative Häufigkeiten von Nebenwirkungen sind wichtige Aussagen. Sie sind aber nur dann aussagekräftig, wenn man für beide Seiten diese Häufigkeiten bestimmen kann. Und wie es im Moment aussieht, ist das Zahlenmaterial dafür nicht ausreichend, um zuverlässige Aussagen machen zu können. Also auch hier eine Sackgasse.
Die Seite, die niemand sehen will
Wie wichtig ist die Senkung von Cholesterin? Wie es den Anschein hat, sind sich hier die Schulmediziner und Alternativmediziner wie Dr. Schmiedel vollkommen einig, dass Cholesterin böse ist und „vernichtet“ werden muss. Worüber man sich streitet, das ist die Art und Weise der „Vernichtung“.
Die Schulmedizin macht es mit ihren „evidenzbasierten, zugelassenen“ Präparaten. Der Alternativmediziner Schmiedel will das Gleiche genauso gut oder besser mit viel weniger Nebenwirkungen mit rotem Reis (oder anderen natürlichen Substanzen) erreichen.
Beide Parteien behaupten, dass das Gros der Nebenwirkungen von den jeweils eingesetzten Substanzen/Produkten ausgeht, also vom Lovastatin/Atorvastatin etc. beziehungsweise vom roten Reis und dem darin enthaltenen Monacolin K. Niemand kommt auch nur auf die Idee, dass die Cholesterinsenkung per se für eine Reihe von Nebenwirkungen verantwortlich ist. Und hier spielt es keine Rolle wie konventionell oder alternativ die Senkung von Cholesterin durchgeführt wird.
Denn Cholesterin ist eine physiologische Substanz, die der Organismus benötigt, besonders die Zellen für den Aufbau der Zellmembranen. Liegt hier ein Mangel vor, dann muss es zu den entsprechenden „Nebenwirkungen“ kommen, die teilweise sehr drastisch sind.
In meinen weiter oben zitierten Beiträgen gehe ich darauf ein, zum Beispiel auf die Senkung von Ubichinon (Q10), was einen direkten Einfluss auf die Effektivität der Energieproduktion in den Mitochondrien hat. Oder mit anderen Worten: Jede Form der unphysiologischen Cholesterinsenkung ist mitochondriotoxisch.
Ist es da verwunderlich, wenn Muskelprobleme auftauchen? Ist es da verwunderlich, dass Gefäßschäden auftauchen, obwohl von der Schulmedizin immer behauptet wird, dass Statine Gefäßschäden verhindern. Wie es aussieht, haben Gefäßschäden in Form von Arteriosklerose mehr mit einem Vitamin-D-Mangel und Vitamin-K2-Mangel zu tun als mit einem zu schwachen Verzehr von Statinen.
Und es gibt Hinweise, dass nicht die pharmazeutischen Produkte für diesen Effekt verantwortlich sind, sondern dass auch natürliche Behandlungsformen mit entsprechenden beeindruckenden Ergebnissen einer Cholesterinsenkung genau diese Effekte haben. Und schlimmer noch!
Diese Arbeit habe ich auch in anderen Beiträgen zitiert. Ich zitiere sie jetzt noch einmal aus zwei Gründen. Grund 1 ist die Tatsache, dass diese Studie kaum Beachtung fand.
Grund 2, da es sich um eine typische Veröffentlichung handelt, die mit unliebsamen Ergebnissen aufwartete und daher über 40 Jahre lang unterdrückt wurde. Die Studie wurde Mitte der siebziger Jahre veröffentlicht (durchgeführt 1968-1973), aber erst von anderen Autoren im Jahr 2016 veröffentlicht und diskutiert.
Es handelt sich nicht um eine Metaanalyse, sondern um eine doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studie, die untersucht hatte, ob die Vermeidung von gesättigten Fettsäuren durch die Gabe von ungesättigten Fettsäuren zu einer Reduktion der Mortalität durch Senkung des Cholesterinspiegels führte. An der Studie nahmen insgesamt über 9400 Probanden teil.
Das Resultat: Die Senkung von Cholesterin durch die Einnahme von ungesättigten Fettsäuren war signifikant. Aber: Ebenso signifikant war die Erhöhung des Mortalitätsrisikos in der Verumgruppe, bei der man die Cholesterinsenkung hat beobachten können. Denn eine Reduktion von Cholesterin von 30 Milligramm pro Deziliter steigerte das Mortalitätsrisiko um 22 Prozent.
Diese Studie zeigt zwei Sachen. Zum Einen kann man mit natürlichen Substanzen signifikant Cholesterinspiegel senken. Wir brauchen keine pharmakologischen Produkte dafür. Es zeigt aber auch zum Anderen, dass eine „blindwütige“ Cholesterinsenkung deletäre Folgen hat, gleichgültig aus welchem Hause der Cholesterinsenker kommt.
Diese Erkenntnis scheint in vielen Bereichen der Schulmedizin noch nicht angekommen zu sein.
Fazit
Diese Erkenntnis scheint auch in einigen Bereichen der Alternativmedizin noch nicht angekommen zu sein.
Von daher ist es kein Wunder, dass ein Dr. Schmiedel sich durch dieses Thema winden muss, da die sich auftuenden Widersprüche auch nicht durch statistische Erwägungen aufgelöst werden können.
Zum Thema Cholesterin und Cholesterinsenker und die damit verbundenen Probleme und Bedenken hatte ich bereits sehr viel veröffentlicht, u.a.
- Cholesterin-Medikamente: Statine verursachen Muskelschmerzen
- Cholesterinsenker Statine: Antiquierte Heilmethode auf dem Prüfstand
- Machen Cholesterinsenker doof?
- Statine: Cholesterinsenker mit eingebautem Diabetes-Risiko
- Gefäßschäden durch Cholesterinsenker?
- Cholesterinsenker – Es wird immer TOLLER
- Statine senken Vitamin Q10 Spiegel
- Cholesterin – Nutzen der Statine wird bezweifelt
- Verklumpung des Bluts wird durch Statine nicht verhindert
- Cholesterin | Cholesterinspiegel senken – Aber Natürlich
Und warum das „Märchen vom bösen Cholesterin“ nicht wahr sein kann: Der Cholesterin Report – Das Märchen vom bösen Cholesterin
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – Stepan Popov