LDL-Cholesterin – warum der Laborwert oft trügt
Die Cholesterin-Hypothese hat schon lange Risse – und trotzdem stützen sich weite Teile der Medizin weiterhin auf fragwürdige Laborwerte. Besonders absurd wird es beim LDL-Cholesterin: Der Wert, der angeblich das kardiovaskuläre Risiko widerspiegelt, wird in der Praxis oft gar nicht direkt gemessen, sondern nur geschätzt – anhand einer Formel, die bei vielen Patienten gar nicht mehr greift. Übergewicht, erhöhte Triglyzeride, Stoffwechselstörungen: All das macht die Berechnung unzuverlässig.
Und das ist noch nicht das größte Problem. Viel entscheidender ist: Es wird das Falsche gemessen. Denn nicht jedes LDL ist gefährlich – sondern vor allem die kleinen, dichten Partikel, die in der Standarddiagnostik überhaupt nicht auftauchen. Aus naturheilkundlicher Sicht ist das nicht nur medizinisch ungenau – es führt auch zu falschen Entscheidungen in der Therapie.
Das Problem liegt in der Laborroutine: LDL-Cholesterin wird meist nicht direkt gemessen, sondern rechnerisch ermittelt – mit der sogenannten Friedewald-Formel. Diese Berechnung funktioniert aber nur unter bestimmten Bedingungen: Die Blutentnahme muss nüchtern erfolgen, die Triglyzeride dürfen nicht erhöht sein, und andere Störfaktoren wie Diabetes oder Übergewicht sollten nicht vorliegen. In der Realität ist das selten der Fall. Das heißt: Die Werte, auf die sich viele Ärzte verlassen, sind oft fehleranfällig.
Noch kritischer: Der LDL-Wert sagt wenig über die Qualität des Cholesterins aus. Denn LDL ist nicht gleich LDL. Es gibt große, eher harmlose Partikel – und kleine, dichte LDL-Partikel, die sich besonders leicht in die Gefäßwände einlagern und entzündliche Prozesse fördern – wenn wir denn schon bei der ganzen Cholesterin-Hypothese bleiben wollen!
Aber: genau diese angeblich „gefährlichen Untertypen“ werden in der Standarddiagnostik gar nicht erfasst. Für eine differenzierte Risikoabschätzung wäre eine Partikelanalyse oder eine Bestimmung der sdLDL (small dense LDL) notwendig – doch diese Verfahren sind aufwendiger, teurer und werden nur selten angeboten.
Aus naturheilkundlicher Sicht greifen wir daher nicht vorschnell zu cholesterinsenkenden Medikamenten, sondern fragen: Warum ist der Fettstoffwechsel aus dem Gleichgewicht geraten? Welche Rolle spielen Leberfunktion, Ernährung, Entzündungsprozesse oder oxidativer Stress? Und vor allem: Wie kann man gezielt den Anteil der schädlichen LDL-Partikel senken, ohne den Organismus zu belasten?
Pflanzenstoffe wie OPC, Artischocke, Mariendistel oder Berberin, ein bewusster Umgang mit Zucker und Industriefetten sowie regelmäßige Bewegung und Fastenintervalle zeigen in der Praxis oft stärkere Effekte als jede Statistik.
Fazit
Solange wir uns auf zweifelhafte Laborformeln und veraltete Cholesterinmodelle verlassen, werden wir am eigentlichen Problem vorbeibehandeln. Es bringt wenig, den Gesamt-LDL-Wert zu senken, wenn wir dabei nicht wissen, welche Partikel wir überhaupt beeinflussen. In der Naturheilkunde schauen wir tiefer: auf Entzündungsprozesse, Leberfunktion, Ernährung und oxidative Belastungen.
Ziel ist nicht ein kosmetisch schöner Laborwert, sondern ein stoffwechselgesunder Mensch. Und dafür braucht es keine Statine, sondern ein durchdachtes Therapiekonzept mit natürlichen Wirkstoffen, klarem Lebensstil und einem kritischen Blick auf die gängige Routine.
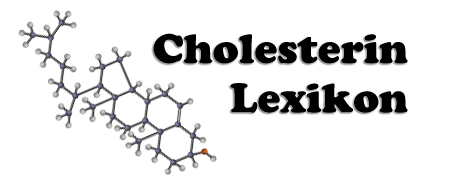

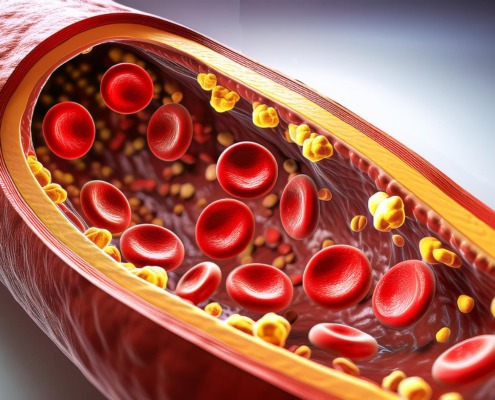




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!